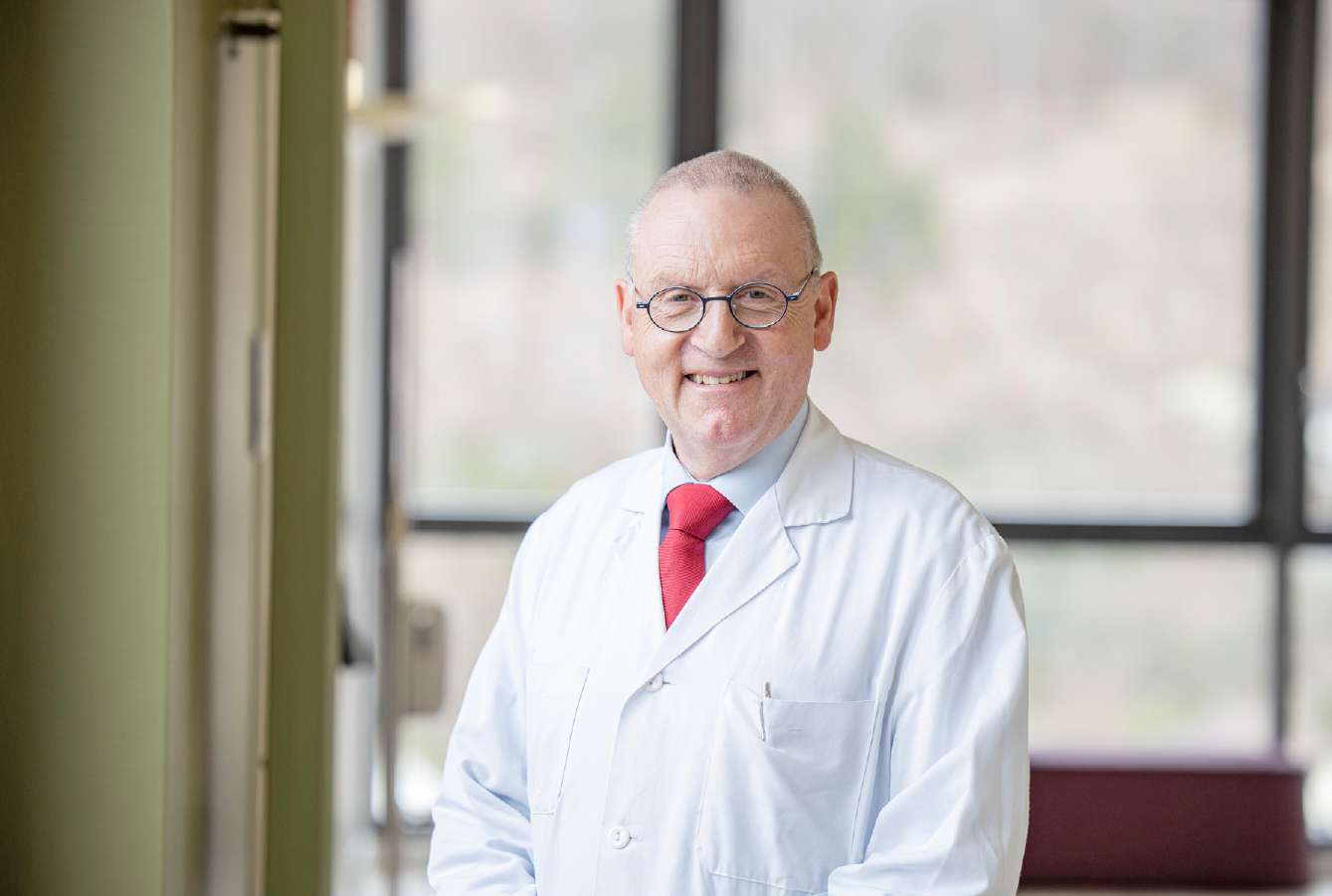«Im Herbst waren wir nicht mehr so vorsichtig»
09.04.2021 Baselbiet, Gesundheit, Bezirk Liestal, GesellschaftJürg Gohl
Herr Leuppi, seit gut einem Jahr leben wir mit Covid-19. Wo stehen wir jetzt auf dieser langen Strecke?
Prof. Dr. Jörg Leuppi: Das hängt natürlich vom Aspekt ab, den Sie betrachten wollen. Medizinisch gesehen haben wir eben die ...
Jürg Gohl
Herr Leuppi, seit gut einem Jahr leben wir mit Covid-19. Wo stehen wir jetzt auf dieser langen Strecke?
Prof. Dr. Jörg Leuppi: Das hängt natürlich vom Aspekt ab, den Sie betrachten wollen. Medizinisch gesehen haben wir eben die zweite Welle hinter uns gebracht und stehen wahrscheinlich unmittelbar vor einer dritten Welle.
Gleichwohl erhält man den Eindruck, dass das Wort Corona nicht mehr den gleichen Schrecken auslöst wie vor einem Jahr. Haben wir den Respekt verloren?
Wir haben gelernt, mit dem Virus umzugehen. Wir haben Erfahrungen gesammelt und bei den Hospitalisationen begriffen, wie und wo wir Medikamente einsetzen, die tatsächlich etwas bewirken und die Folgen der Krankheit beim Einzelnen eindämmen.
Ist das der wesentliche Grund, weshalb die Rate der Todesopfer zurückgeht?
Da spielen zwei Aspekte eine Rolle. Erstens haben wir, wie gesagt, gelernt, die Entzündungsreaktion bei den schwer an Covid-19 Erkrankten zu unterdrücken. So stellten wir fest, dass Cortison-Präparate sehr wohl helfen können. Notabene wendet man das nicht bei jedem Patienten an, weil dies bei milden Verläufen, die sogar zu Hause auskuriert werden können, nicht angezeigt ist. Sicher trägt, und das ist der zweite Aspekt, auch das Impfen dazu bei, dass das Virus nicht mehr so viele Todesopfer fordert. Ältere Leute und Risikopersonen sind inzwischen zu einem schönen Teil geimpft. 7 Prozent der Bevölkerung sind es aktuell. Das entspricht rund einem Zehntel der Impfwilligen.
Welche Rolle spielen die Mutationen?
Sie verunsichern uns. Die neue, aus Brasilien stammende Variante soll gefährlicher sein. Das dürfte sich negativ auf die Zahl der Todesopfer auswirken. Bei der Sterblichkeit spielt immer auch eine Rolle, an welchen anderen Krankheiten eine Person leidet. Man kennt sie: hoher Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Durchblutungsstörungen, Diabetes. Deshalb ist es wichtig, dass wir beim Impfen gerade bei diesen Personen weiterfahren.
Nochmals zu den bekannten Mutationen – welche fürchten Sie mehr, die englische, die brasilianische oder die afrikanischen Varianten?
Die englische Variante herrscht momentan bei uns vor. Die aktuelle Hospitalisationsrate wie auch die Todesrate haben sich zum Glück noch nicht wesentlich geändert. Wir rechnen aber damit, dass insbesondere die Hospitalisationsrate demnächst wieder ansteigen wird. Bei der brasilianischen Mutation weiss man noch nicht so richtig, ob sie bei uns in grösserem Umfang auftreten wird; diese scheint eindeutig gefährlicher zu sein. Die südafrikanische Mutation wurde in der Schweiz erst vereinzelt entdeckt, da fehlen uns die Erfahrungen. Und die Auswirkungen der neuesten Variante aus Tansania sind noch unbekannt.
Bundesrat Alain Berset hat ein Jahr lang gebetsmühlenartig davor gewarnt, dass unser Gesundheitssystem durch die Pandemie überlastet würde. Nun soll sich wenigstens diese Situation ein wenig entspannt haben. Sie stehen täglich im Einsatz. Wie nehmen Sie die Situation wahr?
Auch hier gibt es wiederum zwei Aspekte zu beachten. Der erste betrifft die Überlastung der Intensivbettstationen …
… die offenbar abnimmt.
Ja. Diese Überlastung war vor allem während der ersten Welle ein grosses Thema. Während der zweiten Welle mussten wir weniger Betroffene dorthin verlegen. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass wir, wie bereits gesagt, inzwischen gelernt haben, die Gefährlichkeit einzudämmen. Geholfen hat uns dabei aber auch die ausgezeichnete Zusammenarbeit unter den Intensivstationen in der Region. Das ist wirklich vorbildlich, wie das Universitätsspital Basel, das St. Claraspital und das Kantonsspital Baselland hier zusammenarbeiten. Die Patienten werden immer so verteilt, dass keines der drei Spitäler, gemessen an der jeweiligen Kapazität, an seine Belastungsgrenze gelangt. Aber wir wissen nicht, was mit den nächsten Wellen noch auf uns zukommt.
Wie steht es um das Pflegepersonal? Ist es nicht übermüdet oder zumindest Covidmüde?
Wie bei der Bevölkerung ist auch beim Spitalpersonal, der Pflege und den Ärzten, die auf den Covid-Stationen auf dem Bruderholz und in Liestal arbeiten, eine klare Übermüdung spürbar. Dies nicht zuletzt auch wegen der hohen Schutzmassnahmen. Das ständige Umziehen ist wirklich mühsam. Als wir gleich zu Beginn der Pandemie unser Covid-Referenzspital auf dem Bruderholz bezogen, zeigte sich diese Ermüdung sehr schnell. «Wir sehen und bekämpfen immer nur das Gleiche», lautete der Tenor.
Was unternahmen Sie dagegen?
Wir reagierten auf dieses Problem, indem wir das Personal rotieren, also auf wechselnden Stationen arbeiten liessen und indem wir Covid-Patienten in der Zwischenzeit auch in Liestal hospitalisieren. Wir bieten heute an beiden Standorten für Corona-Patienten das ganze Spektrum an Betreuung an. Das birgt den weiteren Vorteil, dass wir dafür auch auf dem Bruderholz das ganze Spektrum der Spitalversorgung inklusive Notfall und Rehabilitation anbieten können.
Gerade während der ersten Welle gingen dafür andere Krankheiten und Unfälle zurück. So hatte das Gesundheitswesen mehr Kapazitäten für Corona-Kranke und konnte so den Ansturm besser auffangen. Ist diese Rechnung zu einfach?
Bei der ersten Welle hat der Bundesrat verordnet, dass sogenannte Wahleingriffe verschoben werden. Sie waren verboten. Hinzu kam, dass die Leute nicht mehr so viel unterwegs und sportlich aktiv waren, man fuhr weniger Auto. So ereigneten sich tatsächlich weniger Unfälle. Es gab Zeiten, da waren die Notfallstationen aller Spitäler sogar unterbelastet.
Man vernahm auch, dass viele Leute wegen Corona den Gang auf die Notfallstation nicht wagten.
Das war tatsächlich der Fall. Gerade in der ersten Welle getrauten sich viele Leute aus Angst vor einer Ansteckung nicht mehr, ins Spital oder zum Hausarzt zu gehen. Das führte auch zu einer Unterversorgung. Will heissen: Gewisse Herzinfarkte blieben unentdeckt, Tumore wurden zu spät erkannt und so weiter. Deshalb musste die Bevölkerung mit einer Gegenkampagne sogar ermuntert werden, im Zweifelsfall den Arzt aufzusuchen.
Hat sich diese Situation inzwischen verbessert?
Die Patientinnen und Patienten verhalten sich immer noch zurückhaltend. Die Angst davor, sich in einem Wartezimmer anzustecken, ist immer noch zu beobachten, obschon überall die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden: Abstände, Hygiene, zeitliche Staffelungen, Lüften. Auch hier gilt, dass wir alle dazugelernt haben. Und im Spital wissen wir am besten, wie man mit hochinfektiösen Krankheiten umgeht. Das ist nicht erst seit Covid-19 so. Wir betreuen ständig Isolationspatientinnen und -patienten, die zum Beispiel an Grippe oder Norovirus erkrankt sind oder die an einer Antibiotikaresistenz leiden.
Statistisch schneidet Baselland mit 5,2 Neuansteckungen pro Woche auf 100 000 Einwohner vergleichsweise gut ab. Können wir, um eine Formulierung des Bundesrats zu verwenden, Corona im Baselbiet besser?
Mal sind wir oben, mal sind wir unten. Als Basel-Stadt zum Beispiel viel schneller als wir die Maskenpflicht einführte und die Beizen schloss, verzeichneten wir mehr Fälle. Aber es gab auch Phasen, in denen wir sehr gut handelten. Die Politik ist verständlicherweise eben nicht nur für die Gesundheit verantwortlich, sondern auch für eine funktionierende Wirtschaft, einschliesslich der Restaurants, die übrigens die neuen Anforderungen toll umgesetzt haben. Während der ersten Welle hat das auch bestens funktioniert, während der zweiten sind die Leute schon nicht mehr so vorsichtig.
Weshalb?
Da sind wir wieder bei der Pandemie-Müdigkeit angelangt. Entscheidend ist weniger die Frage, was alles erlaubt und verboten ist, sondern wie gut die Bevölkerung mitmacht. Hält man im Privaten die Abstände und die anderen Regeln ein? Trifft man sich drinnen oder draussen? Wie ernst nehmen wir die Situation weiterhin? Solche Fragen entscheiden darüber, wie wir die Pandemie meistern.
Im vergangenen Sommer herrschte nach der ersten Welle ein bisschen die Stimmung vor, dass die Pandemie nun überwunden sei. Was sagen Sie für den kommenden Sommer voraus?
Das ist Kaffeesatzlesen. Wir können aufgrund der steigenden Fallzahlen noch nicht sagen, wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird. Grundsätzlich ist die Ansteckungsgefahr an der frischen Luft geringer, weshalb auch die Grippewelle immer im Winterhalbjahr durchs Land zieht. Apropos Grippe: Interessanterweise war sie im zurückliegenden Winter kein Thema. Das ist wohl auf die Corona-Massnahmen zurückzuführen. Aber wir wissen aus anderen Pandemien wie der Spanischen Grippe, dass es zwei, drei Jahre Geduld benötigt, bis sie überwunden sind.
Aber wir verfügen im Gegensatz zur Zeit vor hundert Jahren über einen Impfstoff.
Richtig. Die Entwicklung hängt stark davon ab, wie schnell wir impfen können. Wir müssen breiter und genug impfen.
Und wie wird das nächste Winterhalbjahr aussehen?
Da wird es immer hypothetischer. Denn wir wissen zum Beispiel noch zu wenig darüber, wie gut und wie lange die Impfungen wirken werden und wie stark das Virus mutiert. Ich gehe davon aus, dass wir lernen müssen, mit Covid-19 zu leben.
Das heisst?
Es ist denkbar, dass sich das soziale Verhalten verändern wird. Das Händeschütteln könnte verschwinden, so sehr ich diese Geste persönlich schätze. Vielleicht hören wir auch mit den Begrüssungsschmützli auf, ersetzen es durch eine weniger ansteckende Umarmung und gewöhnen uns daran, im Alltag vermehrt eine Schutzmaske zu tragen, wie das die Asiaten ja schon lange zu tun pflegen. Als Nebenerscheinung werden auch andere Infektionskrankheiten zurückgehen. Die Grippe, die auch jedes Jahr viele Todesopfer fordert und im Frühjahr alljährlich unsere Spitäler füllt, fiel, wie bereits erwähnt, weg. Akute Fälle der Lungenkrankheit COPD gingen wegen der Corona-Massnahmen ebenfalls spürbar zurück – nicht nur bei uns.
Inzwischen verfügt der Kanton über drei Impfzentren. Zu Lausen und Muttenz kam Laufen hinzu. Die Einrichtungen erhalten viel Lob. Zu Recht?
Ich war selber noch nie dort, vernehme aber Ähnliches. Wichtig ist, dass es mit Impfen vorwärtsgeht und wir bald über einen Stoff verfügen, der nicht auf eine Kühlkette angewiesen ist. So kann er auch von Hausärzten verabreicht werden. Das würde vieles vereinfachen. Wir wären nicht mehr zum Zentralisieren gezwungen. Auch die Impfungen in den Altersheimen verliefen erfolgreich. Was man durchaus mal feststellen darf: Kantonsarzt Samuel Erne organisiert mit seinem Team den Kampf gegen Corona bei uns sehr gut.
Zentral ist auf der anderen Seite die Impfbereitschaft. Von welchen Zahlen gehen Sie da aus?
Genau wissen wir das natürlich erst, wenn sich alle impfen lassen können. Vorher sind wir aber auf Schätzungen und auf den Blick in andere Länder angewiesen und kommen dabei auf einen Wert zwischen 60 und 70 Prozent.
Der Zielwert liegt aber bei 80 Prozent.
Ja, das wäre natürlich grossartig. Da hilft nur, dass wir die Leute motivieren und die Impfskeptiker gut aufklären. Viele Medikamente, und auch Impfungen, die wir Mediziner abgeben, zeigen Nebenwirkungen. Das gilt etwa für Tetanus- oder Grippeimpfung. Aber das ist im Vergleich zum Gewinn so vernichtend klein. Wer einmal an Corona litt oder einen Angehörigen daran verlor, nimmt ein mögliches kurzes und leichtes Fieber noch so gerne in Kauf.
Noch kurz zu zwei Stichwörtern. Das erste: Zunehmend wird auch Long Covid mit seinen lange anhaltenden Symptomen zum Thema. Kann hier die Medizin bereits dagegenhalten oder gilt das Augenmerk der akuten Erkrankung?
7 bis 10 Prozent leiden unter Langzeitschäden, das kennt man auch von anderen viralen Erkrankungen. Bei Long Covid fällt es aber besonders auf. Im Kantonsspital Baselland bieten wir eine Long-Covid-Sprechstunde an, bei der sich Betroffene melden können und dann an die für sie richtige Stelle weiterverwiesen werden. Auch bieten wir eine spezielle Long-Covid-Rehabilitation an.
Das zweite Stichwort betrifft das gegenwärtig lahmgelegte Vereinswesen. Werden wir je wieder im alten Rahmen turnen, singen und musizieren können?
Da habe ich keine Bedenken. Vorher müssen wir aber diszipliniert die dritte Welle überstehen. Auch hier hängt vieles von der Disziplin, den Impfmöglichkeiten und natürlich der Impfbereitschaft ab.
Zur Person
jg. Prof. Dr. Jörg Leuppi ist Facharzt für innere Medizin und Pneumologie am Kantonsspital Baselland in Liestal. Er ist Chefarzt und gehört der Leitung der Medizinischen Universitätsklink an. Als Anfang 2020 das Coronavirus ausbrach und Baselland auf dem Bruderholz ein Corona-Referenzspital einrichtete, wurde Jörg Leuppi mit der medizinischen Leitung betraut. Er ist 1964 in Basel geboren und wuchs dort auf. Mit seiner Familie wohnt er in Muttenz.