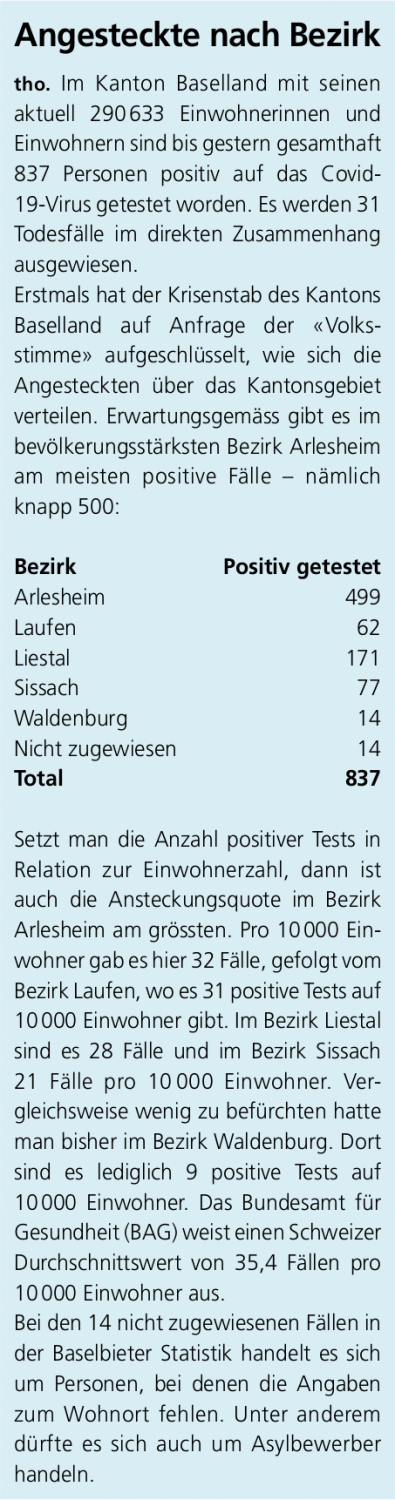"Schulöffnung dürfte zu einer Zunahme der Fallzahlen führen"
15.05.2020 Baselbiet, Gesundheit, PolitikDer Leiter der Infektiologie am Kantonsspital Baselland über den Stand der Covid-19-Erkenntnisse und die möglichen Folgen der Lockerungen
Das Bruderholzspital ist mit dem Eintreffen der Pandemie zur Referenzklinik für Covid-19-Patienten umfunktioniert worden. Prof. Dr. med. Philip Tarr ...
Der Leiter der Infektiologie am Kantonsspital Baselland über den Stand der Covid-19-Erkenntnisse und die möglichen Folgen der Lockerungen
Das Bruderholzspital ist mit dem Eintreffen der Pandemie zur Referenzklinik für Covid-19-Patienten umfunktioniert worden. Prof. Dr. med. Philip Tarr ist Leiter der Infektiologie und Co-Chefarzt der Medizinischen Universitätsklinik am Kantonsspital Baselland. Er zieht eine Zwischenbilanz und wagt einen Ausblick.
David Thommen
Herr Tarr, schauen wir auf die Zahlen: Im Baselbiet gab es am Dienstag noch 14 aktiv an Covid-19 erkrankte Patienten. Nur zwei waren im Spital, einer davon auf der Intensivstation. Die Kapazität im Bruderholzspital wurde auf maximal 350 Covid-19-Betten hochgefahren. Muss man heute sagen, dass mit dem Ausbau der Kapazität übertrieben wurde?
Philip Tarr: Ganz klar nein. Als wir den Entscheid treffen mussten, musste alles sehr schnell gehen. Es war nicht klar, wie sich die Pandemie bei uns entwickeln wird. Die Sorge Anfang März war absolut berechtigt, dass auch wir «lombardische Verhältnisse» in den Spitälern bekommen. Das galt es um jeden Preis zu verhindern. Heute kann man vielleicht sagen, dass wir mit der grossen Kelle angerichtet haben. Der Entscheid war aber absolut richtig. Und im Nachhinein ist man sowieso immer gescheiter.
Es soll nicht nach Vorwurf klingen, aber die Kapazitäten wurden nicht einmal annähernd gebraucht …
Das Gesundheitswesen konnte diese erste Welle nur deshalb so gut bewältigen, weil der Bundesrat einschneidende Massnahmen erlassen hat. Es hätte aber auch bei uns so kommen können wie im Tessin, wo die Spitäler wirklich am Anschlag waren. Hier im Bruderholzspital lagen auf dem «Peak» 17 künstlich beatmete Corona-Patienten gleichzeitig auf der Intensivstation. Wir sind damit bereits fast ans Limit gekommen. Lange hält ein Spital das nicht durch, vor allem fehlt uns das Personal in der Intensivpflege. Die Armee hat uns mit ihrem Einsatz zum Glück geholfen. Ich halte fest: Die Armee ist sehr nützlich. Sie hat eine ganz neue Bedeutung erlangt.
Vorhergesagt wurde, dass ein «Viren-Tsunami» auf uns zukomme. Gibt es einen Hauptgrund dafür, dass diese Prognose nicht eingetroffen ist?
Es ist in der Epidemiologie nie nur eine Massnahme allein. Es gab eine Vielzahl von Einschränkungen, die in der Summe ein gutes Ergebnis brachten. Ich finde, wir haben in der Schweiz einen guten Weg gewählt. Ich bin glücklich darüber, dass bei uns der Lockdown nicht gar so hart ausgefallen ist wie in anderen Ländern, wo man ohne amtliche Bewilligung nicht oder kaum noch aus dem Haus durfte. Bei uns wurde in erster Linie an die Eigenverantwortung appelliert. Das hat funktioniert.
Es ist häufig zu lesen, dass der Rückgang der Fälle bereits vor dem Lockdown eingesetzt hat. Wie ist das zu erklären?
Es gibt tatsächlich eine Studie, die glaubhaft zeigt, dass der Rückgang der Fälle schon eine oder zwei Wochen vor den Schul- und Ladenschliessungen begonnen hat. Aber man darf nicht vergessen, dass schon zuvor Massnahmen getroffen worden sind. Bei uns beispielsweise wurde die Fasnacht abgesagt, was zweifellos richtig war. Im Waadtland, wo es deutlich mehr Fälle gab, waren gewisse Veranstaltungen mit einem Massenauflauf von Menschen länger erlaubt, im Tessin ebenso. Wären auch dort solche Veranstaltungen frühzeitig abgesagt worden, hätte die Welle vermutlich ebenfalls rascher gebrochen werden können.
Anfang dieser Woche ist man überraschend schnell zu einer Art «Teilnormalität» zurückgekehrt: Beizenbesuche sind wieder möglich, alle Läden und Schulen sind geöffnet. Was wird nun passieren?
Das kann niemand mit Sicherheit vorhersagen. Indessen ist es nicht eine Rückkehr zur Normalität, sondern es gibt weiterhin viele Auflagen. Ich bin zuversichtlich, dass es gut kommen wird, da die Menschen ihre Eigenverantwortung wahrnehmen.Aber ich gebe zu, dass ich auch besorgt bin. Ich hätte mir gewünscht, dass die Öffnung etwas dosierter über einen längeren Zeitraum vollzogen wird. Auch, um herauszufinden, wie sich welcher Lockerungsschritt auswirkt. Nehmen die Fallzahlen nun wieder zu, kann man kaum abschätzen, was der Hauptgrund dafür ist. Sind es die Restaurants? Die Läden? Die Schulen? Der öV?
Hat der Bundesrat dem Druck der also zu rasch nachgegeben?
Das würde ich so nicht sagen. Ich fände es ebenfalls schlimm, wenn wir aufgrund der anhaltend strengen Massnahmen eine grosse Konkurswelle bekämen oder die Kinder kaum noch etwas lernen.
Im Gegenzug man nimmt eine zweite Welle in Kauf?
Eine zweite Welle ist keineswegs auszuschliessen. Mich besorgt nicht zuletzt die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Schulen. Die Aussage, wonach Kinder nicht ansteckend sein sollen, hätte eine differenziertere Betrachtung verdient. Ich glaube, dass Kinder ebenfalls zur Verbreitung des Virus beitragen, wenn auch weniger stark als Erwachsene. Ich vermute, dass sich die Schulöffnung in der Zunahme der Fallzahlen widerspiegeln wird. Ich hoffe einfach, dass es bei einer milden zweiten Welle bleibt.
Sie würden den Grosseltern also nicht empfehlen, ihre Enkel zu umarmen?
Nein, das würde ich nicht. Und es gibt weltweit namhafte Experten, die das auch nicht empfehlen.
Hat hier das Bundesamt für Gesundheit (BAG) voreilig gehandelt und kommuniziert?
Der Bund hat während dieser Krise sehr vieles richtig gemacht und ich möchte niemanden kritisieren. Doch in diesem Fall hat es eine Schwarz-Weiss-Kommunikation gegeben, die in meinen Augen nicht besonders klug war.
Zurück zum Virus: Was weiss man heute mehr darüber als noch vor zwei oder drei Monaten?
Leider nicht sehr viel mehr. Vor allem können wir den Ärzten immer noch keine Empfehlung darüber abgeben, welche Massnahme oder welche Medikamente bei der Behandlung besonders gut helfen würden. Über eine Impfung wissen wir ebenfalls nicht viel mehr. Und auch nicht darüber, ob man nach einer durchgemachten Krankheit tatsächlich immun ist. Wir sind heute etwas weniger weit, als wir uns das alle erhofft haben. Vielleicht wissen wir bis zum Herbst mehr.
Ist das Virus so komplex? Schliesslich ist die ganze Welt am Forschen ...
Nein. Jede gute Forschung braucht viel Zeit und viel Geld. Das ist normal.
Was ist an diesem Virus so überraschend?
Als gesichert gilt heute, dass man bereits ansteckend ist, bevor sich überhaupt erste Krankheitssymptome zeigen. Das ist genau das, was Covid-19 auch so schwer einzudämmen macht. Alle Pandemiepläne auf der ganzen Welt gingen nicht von einer solch überraschenden Eigenschaft aus. Solange sich keine Symptome zeigen, kann man auch niemanden isolieren, um die Ansteckungskette sofort zu unterbrechen. Zudem überraschend – und für uns Ärzte frustrierend – ist, dass sich der Krankheitsverlauf von Patienten nicht gut vorhersagen lässt. Wir finden keine Anhaltspunkte für eine treffsichere Prognose. Es zeigt sich erst nach acht bis zehn Tagen, ob es einen milderen oder – zum Glück selten – einen fast schlagartig sehr schweren Verlauf gibt. Man muss heute davon ausgehen, dass es vererbte Eigenschaften gibt, die über Glück oder Pech entscheiden.
Warum ausgerechnet trifft dieses Virus vor allem die älteren Menschen?
Abschliessend ist uns das noch nicht klar. Was sicher ist: Ältere Leute haben häufig einfach mehr Risikofaktoren. Ein gesunder 70-Jähriger ist weniger gefährdet als ein 60-Jähriger mit beispielsweise einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Ist also weniger das Alter als solches ein Risiko, sondern vielmehr die Vorerkrankungen?
Ich sehe das heute so. Aber darüber gibt es keine abschliessende Klarheit. Wir stellen fest, dass es bei 20 oder 25 Prozent der schwer Erkrankten keine klar erkennbaren Risikofaktoren gab – also weder hohes Alter noch einschlägige Vorerkrankungen.
Was richtet das Virus eigentlich genau an im Körper?
Etwa 85 Prozent der Patienten haben einen milden Verlauf. Man könnte es mit einer Erkältung vergleichen; hier richtet das Virus also keinen grossen Schaden an. 10 Prozent bekommen eine Lungenentzündung und bei 5 Prozent kommt es zu einer schweren Entzündung sozusagen des ganzen Körpers. In diesen Fällen haben wir es mit einer überschiessenden Entzündungsreaktion zu tun, welche die Angesteckten sehr schwer krank macht. Das Immunsystem explodiert sozusagen.
Dann ist also weniger das Virus das eigentliche Problem, sondern das eigene Immunsystem?
Man könnte das so sagen. Bei Covid-19 kann die Immunreaktion ungeheuer stark ausfallen und sich gegen den Körper selber richten.
Ist es die schiere Menge an Viren, die zum Problem wird?
Nein. Die Viren sind vermutlich nach rund neun Tagen nicht mehr vermehrungsfähig. Das wäre ja eigentlich beruhigend für die Patienten und man könnte denken, nach dieser Zeit sei die Krankheit überstanden. Doch eben, wenn das Immunsystem einmal mit dem Reagieren begonnen hat, lässt sich das in manchen Fällen kaum noch stoppen.
Das heisst, man sucht nun nicht unbedingt ein Medikament gegen das Virus, sondern gegen die überschiessende Immunabwehr?
Man sucht beides. Schön wäre es, wenn man Covid-19 mit einem Medikament sofort abtöten könnte. Das Problem ist allerdings, dass viele Patienten nach dem Auftreten der ersten Symptome erfahrungsgemäss lange warten, bis sie einen Arzt aufsuchen. Sie gehen von einer ganz normalen Erkältung aus. Daher braucht es für solche Patienten, bei denen die Immunabwehr zum Problem wird, zusätzlich auch ein sogenanntes Immun-modulierendes Medikament.
Dass das Immunsystem überreagiert, kennt man beispielsweise von Allergien. Stark vereinfacht: Gibt es Parallelen zum Heuschnupfen?
Wir kannten bislang eine vergleichbar heftige Reaktion als mögliche Nebenwirkung bei der Verabreichung von speziellen Medikamenten gegen schwarzen Hautkrebs. Aber tatsächlich ist der Vergleich mit dem Heuschnupfen nicht ganz falsch: Es macht ja keinen Sinn, dass der Körper des Menschen auf Pollen reagiert, da die Pollen dem Menschen gar nicht schaden. Es handelt sich auch hier um eine überschiessende Immunantwort. Das Ausmass ist einfach deutlich weniger gravierend als bei Covid-19.
Es ist nach wie vor unglaublich viel und viel verschiedenes über den Ansteckungsweg zu lesen. Was gilt heute als gesichert? Sind es tatsächlich vor allem die Tröpfchen? Oder die sogenannten Aerosole, über die man so viel hört?
Die Viren kann man im Nasen- und Rachenraum nachweisen. Wenn man hustet oder niest, fliegen diese Viren zusammen mit den Tröpfchen hinaus. Sie fallen bekanntlich nach 1,50 oder 2 Metern zu Boden, daher ist Abstand auch so wichtig. An die Übertragbarkeit durch Aerosole – also dass die Viren lange Zeit in der Luft schweben – glaubt man heute eher weniger. Aerosole entstehen nur unter sehr extremen Bedingungen. Zum Beispiel, wenn auf einer Intensivstation ein Patient an eine Atemmaschine angeschlossen wird. Das ist relativ dramatisch, weil die Patienten dabei würgen und stark husten. Dann können sich Aerosole bilden.
Davor muss man sich also kaum fürchten?
Eher nicht, schon gar nicht draussen im Gartenrestaurant oder beim Spaziergang. Ich würde sogar so weit gehen und sagen: Draussen finden mit 2 Meter Abstand über die Luft keine Ansteckungen statt, da die Viren sofort stark verdünnt werden. Anders ist es, wenn man in einem Raum wie einer Bar mit 50 anderen Personen eingezwängt ist. Heikel wird es vor allem, wenn sehr laut gesprochen oder gar geschrien wird. Weniger problematisch ist es, wenn man diskret miteinander spricht. Das sind Nuancen, die wir beachten sollten.
Bei den Abstandsregeln gibt es je nach Land verschiedene Vorschriften. Woran sollte man sich laut den letzten Erkenntnissen halten?
Die WHO spricht von 1 Meter, Deutschland von 1,50 und die Schweiz von 2 Metern. Ich meine, dass wir mit 2 Metern bestimmt auf der sicheren Seite sind.
Gibt es neue Erkenntnisse darüber, ob man sich tatsächlich durch Viren, die auch auf Oberflächen haften, anstecken kann?
Man ist sich einig, dass das möglich ist. Doch das spielt eine ziemlich untergeordnete Rolle: Der weitaus grösste Teil der Ansteckungen passiert über das Niesen, Husten und laute Sprechen. Viren, die auf einem Tisch liegen, sind nach einer oder zwei Stunden tot. Man steckt sich nur an, wenn man sich nach dem Kontakt direkt in die Nase fasst.
Man kann von Menschen lesen, die das Geld im Backofen erhitzen oder sich nicht mehr trauen, einen Liftknopf zu drücken. Übertreiben sie alle?
Man sollte sich selber nicht wahnsinnig machen. Wenn man sich beispielsweise beim Einkaufen nicht an die Nase fasst und die Hände gewissenhaft desinfiziert, sollte nichts passieren.
Was bereits äusserst kontrovers diskutiert worden ist, ist die Frage, ob man Ansteckungen cmit Schutzmasken verhindern kann. Eine eindeutige Antwort haben wir in der Schweiz dazu nie bekommen. Wie stehen Sie dazu?
Eine abschliessende wissenschaftliche Antwort mag heute noch ausstehen. Was es jetzt hingegen braucht, ist eine eindeutige Handlungsempfehlung. Das Statement müsste lauten: Zieht eine Maske an, wenn es die Situation verlangt. Schauen Sie, wir sind hier im Spital, wo sämtliche Corona-Fälle des ganzen Kantons behandelt werden. Wir alle tragen Masken und es hat beim Gesundheitspersonal schweizweit nur ganz wenige Ansteckungsfälle gegeben. Die Masken schützen also ohne jegliche Zweifel, auch solche, die man im Supermarkt kaufen kann. Ich würde sie je nach Situation, wie zum Beispiel im öV, auf jeden Fall empfehlen.
Das BAG sagte während Wochen etwas anderes. War das einfach so etwas wie eine Schutzbehauptung, um zu vertuschen, dass man viel weniger Masken hatte, als eigentlich vorgeschrieben gewesen wären?
Ich würde mir wünschen, dass man in der Kommunikation auch Schwächen eingestehen kann. Kurz: Die Maske nützt höchstwahrscheinlich, also sollten wir sie auch anziehen.
Ist bereits klar, woher die Viren ursprünglich in die Region Basel eingeschleppt worden sind?
Das kann mittels Gen-Analysen untersucht werden. Soweit ich weiss, gibt es genaue Ergebnisse für die Region noch nicht. Spannend wird auch sein, ob das Virus seinen Ursprung tatsächlich in Wuhan in China hatte. Vieles deutet zwar darauf hin, doch ich schliesse dennoch nicht ganz aus, dass es bereits im August oder September 2019 erstmals an einem ganz anderen Ort der Welt aufgetreten sein könnte. Schade, dass die Chinesen ihre Daten bislang nicht offenlegen.
Die ersten beiden Corona-Toten im Baselbiet sollen sich zuvor bei einem Gottesdienst einer Freikirche im Elsass angesteckt haben. Könnte das der Ursprung der Epidemie bei uns gewesen sein?
Ich denke, dass das Virus auf verschiedensten Wegen in unsere weltweit stark vernetzte Region gekommen ist. Aber letztlich ist diese Frage auch unerheblich.
Sie haben die einst prekäre Situation in der Lombardei bereits angesprochen. Weshalb ist es dort in den Spitälern so viel schlimmer gekommen als beispielsweise im Bruderholzspital?
Warum ist es in der Lombardei so schlimm gekommen und in der Toscana und bei uns nicht? Es mag viel Zufall mitgespielt haben, ich kann es nicht sagen.
Ist es nicht so, dass es in Italien zum teil gröbste Fehler bei der Bewältigung der Krise gegeben hat? Medien berichteten, dass Covid-19-Patienten in Altersheime verlegt wurden, nachdem die Spitäler voll waren …
Rückblickend würde man das sicher nicht mehr machen. Ich möchte aber eine andere Tatsache anführen: In Wuhan hat man den Lockdown nach 5 Tagen gemacht, nachdem es die ersten 100 Fälle gegeben hatte. In der Schweiz folgte der Lockdown nach 11 Tagen und in Italien erst nach 17 Tagen. Ich will damit sagen: Hätte die Schweiz 6 Tage länger zugewartet, hätten wir vielleicht ebenfalls Zustände wie in Norditalien bekommen. Generell lässt sich feststellen, dass in Ländern wie Italien oder auch Spanien bei der Gesundheitsversorgung in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht zu viel gespart worden ist, was die Bewältigung der Krise zusätzlich erschwert hat.
In Online-Foren oder Leserbriefen in den Zeitungen ist zu lesen, dass Corona kaum schlimmer sei als eine «normale» Grippe. Was sagen Sie dazu?
Das ist eindeutig falsch. Es ist bisher nur so glimpflich abgelaufen, weil wir so entschlossen reagiert haben.
Und das müssen wir wiederholen, sollte es zu einer zweiten Welle kommen?
Ja, wir müssen das wiederholen. Ich kann Ihnen versichern, dass alle Pläne dafür griffbereit auf den Schreibtischen der Behörden liegen. Als gesichert gilt, dass die Fallzahlen nach dem grossen Lockerungsschritt von dieser Woche nun wieder zunehmen werden. Hoffen wir einfach, dass die kritische Grenze bei den Ansteckungen nicht überschritten wird.
Wie viele Menschen haben sich bei uns möglicherweise bereits angesteckt und sind vielleicht immun?
Das ist unsicher. Man kann von 1, 3 oder maximal 10 Prozent ausgehen. Auf jeden Fall sind wir weit entfernt von einer sogenannten Herdenimmunität. Erst wenn 60 oder 70 Prozent der Bevölkerung immunisiert wären, würde dies die Ausbreitung der Krankheit stark bremsen.
Das Konzept «Herdenimmunität» ist also illusorisch?
Momentan: absolut!
Wann sind wir das Virus oder die Sorgen darum endlich los?
Die Immunologen, die eine Impfung bereits für September vorhersagen, sind meiner Meinung nach zu optimistisch. Ich persönlich rechne damit, dass es mindestens noch ein Jahr dauern wird, bis wir in der Schweiz im grossen Stil impfen können. Solange es die Impfung nicht gibt, werden wir mit Covid-19 leben müssen und eventuell ein Auf und Ab mit verschiedenen Massnahmen erleben. Wir sollten nun also noch viele Masken beschaffen. Schlimmstenfalls können wir sie einlagern und dann bei einer nächsten Pandemie wieder hervorholen.
Zur Person
vs. Geboren und aufgewachsen ist Philip Tarr (1968) in Basel. 1994 erwarb er das Staatsexamen an der Universität Zürich. Die Facharztausbildung in innerer Medizin erfolgte in den USA. Von 2002 bis 2007 war Tarr als Oberarzt Infektiologie am Unispital Lausanne tätig und danach von 2007 bis 2016 als Leitender Arzt Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Baselland Bruderholz. Seit April 2016 ist er Co-Chefarzt an der Medizinischen Universitätsklinik KSBL. Die Habilitation auf dem Gebiet der Infektiologie erfolgte 2010 an der Uni Basel. Philip Tarr wohnt in Arlesheim. In seiner Freizeit spielt er Pauken und Schlaginstrumente, so zum Beispiel beim Barockorchester La Cetra.