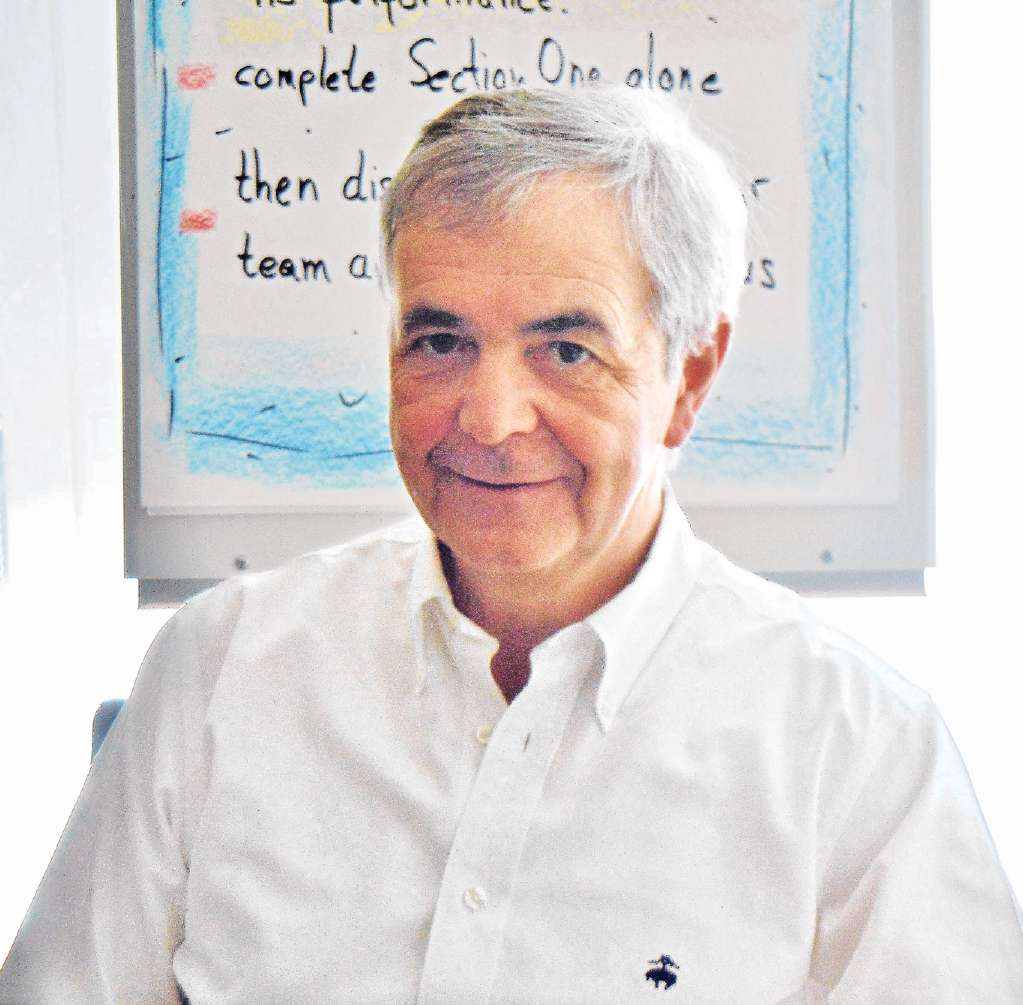«Als Chef muss man Menschen gern haben»
07.04.2020 Bezirk Sissach, Wirtschaft, SissachWas macht eigentlich Guy Kempfert heute? Wir haben uns zum Gespräch getroffen
Guy Kempfert aus Sissach hat eine aussergewöhnliche berufliche Laufbahn erlebt: Rektor des Gymnasiums Liestal, «Global Head Learning & Development» in weltweit tätiger Privatindustrie, Inhaber und ...
Was macht eigentlich Guy Kempfert heute? Wir haben uns zum Gespräch getroffen
Guy Kempfert aus Sissach hat eine aussergewöhnliche berufliche Laufbahn erlebt: Rektor des Gymnasiums Liestal, «Global Head Learning & Development» in weltweit tätiger Privatindustrie, Inhaber und Direktor seiner Beratungsfirma Culture Works.
Andreas Bitterlin
Herr Kempfert, mit Ihrer Firma Culture Works beraten Sie heute Unternehmen und Schulen in der Kulturentwicklung, vor Jahren haben Sie als Rektor Schüler am Gymnasium Liestal unterrichtet. Wo liegt der Unterschied zwischen dem Schulen von Jugendlichen und dem Coachen von etablierten Berufsleuten?
Guy Kempfert: In der Schule wird primär Wissen vermittelt, in der Privatwirtschaft geht es um Verhaltensänderungen. Natürlich habe ich in der Schule auch soziale Aspekte gefördert, aber primär ging es um Wissen in den einzelnen Fächern. In der Wirtschaft müssen Sie den Managern nicht Wissensinhalte vermitteln, das lernen sie woanders. Es geht darum, dass sie ihr Verhalten reflektieren und zu Schlussfolgerungen kommen, die sie auch umsetzen.
Gibt es auch Parallelen beim Umgang mit Jugendlichen und mit Erwachsenen in der Bildung und Weiterbildung?
Egal ob ich Jugendliche oder Führungskräfte im Raum habe – es gibt immer eine Gruppendynamik, die man beachten muss und es gilt bei beiden, einen Spannungsbogen zu erzeugen, damit die Leute am Ball bleiben. Unterricht und Weiterbildungen bedingen allesamt – unabhängig von der Kundschaft – Kompetenzen beim Führen von Gruppen, beim Motivieren, beim Reagieren und bei der Flexibilität.
Was tun Sie heute als Unternehmer?
Viele Organisationen haben inzwischen erkannt, dass eine konstruktive Kultur die Basis für ihren Erfolg darstellt. Ich berate und begleite Unternehmen und Schulen dabei, diese Kultur zu definieren und mit geeigneten Massnahmen auch zu entwickeln. Das ist keine Angelegenheit von heute auf morgen, sondern ein Prozess, der länger dauern kann. Ziel ist dabei, dass sich eine Veränderung einstellt, die zu einem besseren wirtschaftlichen Ergebnis führt. Die Grundvoraussetzung für ein Gelingen dieser Veränderung ist, Vertrauen aufzubauen. Sonst läuft gar nichts. Und dazu begleite ich Führungskräfte und ihre Teams und führe mit ihnen Coachings und Workshops durch, um diese Veränderungen nachhaltig zu implementieren.
Was ist Ihr Credo bei der Führungsqualität?
Als Führungskraft muss man die Menschen gern haben, mit denen man zusammen arbeitet. Und das Allerwichtigste ist die Fähigkeit, im Team Vertrauen aufzubauen. Dann kann man sogar Berge versetzen.
2008 haben Sie eine abrupte und ungewöhnliche berufliche Umorientierung vollzogen. Sie wechselten als Rektor des Gymnasiums Liestal und somit als Staatsangestellter in die Privatindustrie zum Agrochemie- Konzern Syngenta. Was reizte Sie an dieser Herausforderung?
Ich war 14 Jahre Schulleiter und habe zusammen mit dem Schulleitungsteam viel erreicht: Zum Beispiel die Einführung einer bilingualen Matur, das heisst, wir etablierten als erstes Gymnasium der Schweiz eine Matur in Deutsch und Englisch. Des Weiteren realisierten wir unter anderem auch den Bau einer Mensa. Das Wichtigste aus meiner Sicht war allerdings, dass sich mit der Zeit eine innovative Kultur entwickelt hat. Ich wollte allerdings nicht nochmals ebenso lange bis zur Pensionierung dasselbe tun. Ich erhielt ein Angebot von Syngenta, wo ich zuvor schon einen halbjährigen Einsatz geleistet hatte. Ich nahm es an, auch weil das internationale Umfeld verlockend war.
Sie waren «Global Head Learning & Development». Was war Ihre Aufgabe?
Es ging darum, eine globale Weiterbildung aufzubauen. Bis zu jenem Zeitpunkt wurde die Weiterbildung über Novartis abgewickelt, dem ursprünglichen Stammhaus der Syngenta. Meine Aufgabe war es, Konzepte zu entwickeln, ein Team aufzubauen und das ganze firmenintern weltweit zu implementieren.
Kann ein Weiterbildungskonzept weltweit über einen Leisten geschlagen und überall identisch eingeführt werden?
Das wäre niemals akzeptiert worden. In allen Regionen gab es kulturelle Aspekte, und deshalb haben wir globale Standards definiert und gleichwohl nationale Eigenheiten berücksichtigt.
Wie gingen Sie bei Ihrem Wechsel damit um, dass die Syngenta in verschiedenen Geschäftsfeldern umstritten war, etwa in der Gentechnologie? Wie gingen Sie mit negativen Schlagzeilen und Protest verschiedener Bevölkerungskreise um?
Ich habe mich natürlich vor meinem Wechsel mit den Themen Gentechnologie und biologische Landwirtschaft befasst. Ich bin überzeugt, dass die bald 10 Milliarden Menschen auf der Erde ohne Gentech-Saatgut und chemische Pflanzenschutzmittel nicht leben können. Allein mit biologischer Landwirtschaft können alle diese Menschen nicht ernährt werden. Und es gibt zudem keine Studie, die belegt, dass aufgrund gentechnisch veränderter Pflanzen irgendein Schaden entstanden ist.
Für Sie ist also unbestritten, dass kein Risiko besteht. Bei andern neuen Technologien – etwa bei Atomkraftwerken – ist bei vielen Menschen nach Katastrophen wie Tschernobyl und Fukushima eine kritische Zukunftsgläubigkeit in Angst und Ablehnung gekippt. Verstehen Sie Menschen, die Angst haben, dass auch die Gentechnologie aus dem Ruder laufen kann?
Das verstehe ich. Alles, was neu ist, verursacht Ängste, die man auch ernst nehmen muss. Aber mich ärgert, wenn Leute wissenschaftliche Erkenntnisse bewusst nicht zur Kenntnis nehmen und daraus auch noch politisches Kapital schlagen.
In einem Interview wurden Sie 2008 auf einen Kurs angesprochen, an dem Sie teilgenommen haben: «Macht der Multis. Was man dagegen tun kann». Danach wechselten Sie zu einem Multi. Entwickelten Sie sich statt vom Saulus zum Paulus also vom Paulus zum Saulus?
Man macht ja gewisse Entwicklungsstufen durch, man darf ja seine Meinung auch ändern. Aber ich bin nach wie vor gegenüber gewissen Geschäftspraktiken sehr kritisch.
Bitte, ein konkretes Beispiel.
Wenn ich sehe, wie gewisse Unternehmen die Bodenschätze in armen Ländern ohne Rücksicht auf die Auswirkungen ausbeuten und dabei mit korrupten Regierungen zusammenarbeiten und quasi das Land verwüsten, dann kann ich das keineswegs akzeptieren. Bei der Syngenta sehe ich, dass sie Saatgut und Pflanzenschutzmittel herstellt mit der Bemühung, zum Beispiel Pflanzen zu entwickeln, die möglichst wenig Wasser brauchen. Das ist positiv; wie auch, dass den Bauern gezeigt wird, wie sie mit den Produkten umgehen müssen. Das ist etwas anderes, als Menschen und Länder auszubeuten.
Aber auch die Syngenta wurde angeprangert, weil man im Grundwasser Giftrückstände fand von einem Syngenta-Herbizid. Alles ist auch nicht Gold, was glänzt.
Das ist eindeutig so, das ist nicht gut. Da muss sich Syngenta engagieren.
Zurück zu Ihrer Zeit am Gymnasium: Eigentlich ist die öffentliche Hand für Bauten der öffentlichen Schulen zuständig. Sie haben als Rektor des Gyms Liestal im Jahr 2001 eine Mensa erstellen lassen, die zu 80 Prozent privat finanziert worden ist. Wie kam dieses aussergewöhnliche Projekt zustande?
Wir erhielten die Erlaubnis, ein Teilautonomie-Projekt zu entwickeln. In diesem Zusammenhang suchte ich private Partner und fand grosszügige Sponsoren. Wir entwickelten ein Konzept, und der Kanton hat sich dann bereit erklärt, uns das Land zur Verfügung zu stellen sowie das Wasser und die Reinigung zu finanzieren. Allerdings fand die Baukommission dann noch einen Stolperstein und stellte uns die Frage: «Was geschieht, wenn ein Meteorit in die Mensa einschlägt und Schüler verletzt – wer ist haftbar?»
Und fanden Sie eine Antwort?
Nein, aber dank toller Unterstützung von Politikern, Unternehmern, Lehrpersonen und Schülern konnten wir das Projekt erfolgreich umsetzen.
Sie haben 2001, als erstes Schweizer Gymnasium, die zweisprachige Matur Deutsch/Englisch eingeführt. Was hat Sie dazu motiviert?
Die Anzahl der Latein- und Griechischschüler sank rapid, und wir suchten nach einer innovativen Lösung. Und da bot sich der zweisprachige Unterricht an, in dem zahlreiche Fächer auf Englisch unterrichtet werden.Teilnahmeberechtigt waren aber ausschliesslich Latein- und Griechischschüler.
Was haben denn Latein und Englisch gemeinsam?
Mein Entscheid war schon willkürlich, aber der Sinn war, Latein wieder zu stärken. Und es war eine Begabten-Förderung. Nachdem die Schüler im Progymnasium drei Jahre Englisch gelernt hatten, mussten sie nun im Gymnasium in fünf Fächern Unterricht von Lehrern englischer Muttersprache verarbeiten. Das ist vor allem am Anfang hart. Deshalb war es ein Programm für begabte und lernbereite Schüler, und die meisten Lateinschüler zeichneten sich dadurch aus. Das Projekt war auch äusserst erfolgreich. Inzwischen wird diese bilinguale Matur erfolgreich auch in anderen Profilen angeboten.
Die allgemeine Losung heute heisst: Bitte mehr Schüler in den Naturwissenschaften ausbilden, es herrscht ein Mangel an solchen Absolventen.
Es ist sicherlich richtig, Naturwissenschaften stärker ins Zentrum zu stellen – ohne jedoch die Geisteswissenschaften zu vernachlässigen!
Zur Person
abi. Guy Kempfert (65) machte 1975 am Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal Abitur, studierte an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Englisch, Geschichte, Politik, Pädagogik und schloss 1982 das Studium in Geschichte, Englisch und Pädagogik an der Universität Basel mit dem Lizenziat ab. Von 1977 bis 1988 studierte er an der «London School of Economics and Political Science».
Ab 1994 leitete er das Gymnasium Liestal als Rektor und wechselte 2008 in die Privatwirtschaft zur Syngenta als «Global Head Learning & Development» (Verantwortlicher für Weiterbildung). Nach weiteren Stationen in der Privatindustrie gründete er 2018 in Sissach sein eigenes Unternehmen Culture Works, mit dem er als Moderator, Berater und Coach Firmen in Führungskräfte- und Teamentwicklung und bei Veränderungsprozessen unterstützt.
Guy Kempfert tankt, wie er sagt, Energie aus der Arbeit mit Menschen, geniesst seine vielköpfige Familie, reist und liest gern und spielt leidenschaftlich gerne mit Bällen – egal ob auf dem Fussball-, Tennisoder Golfplatz.