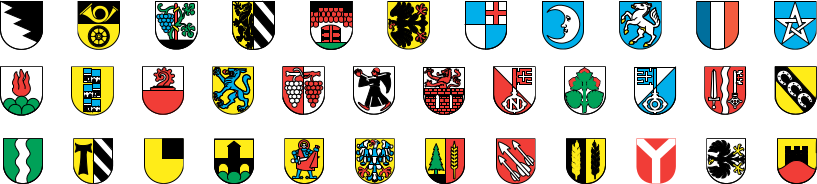Chatze, Güllerugger, Rossbolle und Öpfelschnitzer
30.10.2020 Baselbiet, Gemeinden, GesellschaftFrüher hatte jede Gemeinde einen mehr oder weniger schmeichelhaften «Necknamen»
Einst gab es für alle Baselbieter Dörfer einen Spitznamen. Meist waren es die Bewohner der umliegenden Dörfer, die ihre Nachbarn damit ärgern wollten. Wie nannte man Ihre Gemeinde? Eine ...
Früher hatte jede Gemeinde einen mehr oder weniger schmeichelhaften «Necknamen»
Einst gab es für alle Baselbieter Dörfer einen Spitznamen. Meist waren es die Bewohner der umliegenden Dörfer, die ihre Nachbarn damit ärgern wollten. Wie nannte man Ihre Gemeinde? Eine Übersicht.
tho. Der Begriff «Zypperliränze» tauchte jüngst in der «Volksstimme»-Kolumne «Ahnig vo Botanik» des Gelterkinder Biologen Andres Klein auf. «Zypperliränze» oder «Zypperlifrässer» seien einst die Langenbrucker wegen ihrer Vorliebe für kleine Pflaumen – eben «Zypperli» – genannt worden. Dieser «Neck-Name» machte uns auf der Redaktion neugierig – und siehe da: Nicht nur das Passdorf hatte von den Nachbarn einen solch wenig schmeichelhaften Spitznamen verpasst bekommen, auch für alle anderen Dörfer oder deren Bewohner gab es früher Übernamen. Einige wenige davon dürften noch heute geläufig sein, andere sind in Vergessenheit geraten.
Gesammelt wurden die Scherznamen einst von G. A. Seiler im Buch «Basler Mundart» aus dem Jahr 1879. Basis dafür war ein Gedicht des Frenkendörfers Heinrich Martin («Landschryyberhäiri») aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, in dem alle Necknamen vorkamen (natürlich noch ohne die Gemeinden aus dem Laufental). In der Zeitschrift «Baselbieter Heimatblätter» wurde das rund 140 Zeilen lange Gedicht im Jahr 1958 nachgedruckt, zusätzlich wurden alle Dorf-Necknamen kurz erläutert. Diese Erläuterungen drucken wir hier mit kleinen redaktionellen Anpassungen in der Mundartschreibweise nach. Viel Vergnügen!
Aesch: Chrüüselischnitzer, Chrüüselibeerischnitzer. Chrusle, Chrüüseli (= Stachelbeere). Mit dem Schnitzen dieser Beeren will man den sparsamen, allzu haushälterischen Sinn dieser Dorfbewohner kennzeichnen.
Allschwil: Chruttstorze (Kohl-, Kabisstrünke). Vielleicht ein Hinweis darauf, dass Kohlgerichte (Kohl, Kabis) in dieser Ortschaft beliebt waren.
Anwil: Gugger, zu Kuckuck, im Sinne einer pfiffigen, durchtriebenen, gerissenen Person. Entsprechend der aussichtsreichen Lage des Bergdörfleins könnte auch das Verb gugge = luege (sehen) mit im Spiele gewesen sein.
Arboldswil: Chüechlibärger, womit die Berglage des Dorfes und die Vorliebe der Bewohner für die Küchlein gekennzeichnet werden. In der Umgebung heissen die Arboldswiler Chrotte (Kröten). Vielleicht gaben die im Dorfweiher häufigen Stäichröttli (Geburtshelferkröte) den Anlass zu diesem Namen.
Arisdorf: Graubüntel. Die Herkunft dieses Namens ist heute unsicher. Fraglich, ob Bündel = Bändel gemeint war oder aber Büntel = in ein Tuch, Netz oder einen Sack straff eingebundene Menge von Dingen (Habseligkeiten, Reiseeffekten).
Arlesheim: Chrallezeller (Rosenkranz). Dieser Ausdruck für die «Domstädter» könnte in der reformierten Nachbargemeinde Münchenstein geprägt worden sein. Die Arlesheimer wurden auch Saubohnen genannt, was auf den Anbau von Ackerbohnen hindeutet.
Augst: Chröpf. Zu Kropf = Vergrösserung der Schilddrüse. Das häufige Auftreten des Kropfes in gewissen Gegenden (z. B. Riehen, Lauwil) hing früher mit der Bodenbeschaffenheit, den Quellwasserverhältnissen und anderen Faktoren zusammen. Durch die Verwendung von jodiertem Kochsalz ist es gelungen, den Kropf bei Kindern und jugendlichen Erwachsenen zum Verschwinden zu bringen.
Bärenwil (Langenbruck): Lyyrechübel. Lyyrum, Lyyrechüübel = grosses Butterfass, das zum Buttern gedreht wird. Hinweis auf früher häufige Butter- und Alpwirtschaft.
Benken (Biel-Benken): Schingge, Schungge = Schinken. Vielleicht spielte die Schweinehaltung früher in Benken eine grössere Rolle als in den Nachbardörfern.
Bennwil: Löffelschlyffer oder Löffelschwänker. Fraglich, ob mit Löffelschlyffi eine Schleifmühle, die durch ein mit hohlen, löffelähnlichen Speichen versehenes Wasserrad getrieben wird, gemeint war, oder ob der Begriff im Sinne einer Schule, Anstalt, welche gesellschaftlichen Schliff vermittelt, verwendet wurde.
Biel (Biel-Benken): Stäägstregger. In früheren Jahren wollte man einmal einen Steg über den Birsig erstellen. Er geriet zu kurz und die Bieler versuchten vergeblich, ihn mit einem Pferdezug in die Länge zu ziehen. Das Schildbürgerstücklein trug ihnen den Necknamen Stäägstregger ein.
Binningen: Weiechöpf. Das Pfaffenröhrlein (Löwenzahn) heisst in Binningen Weieschwanz. Wahrscheinlich wurden die Einwohner des früheren Bauerndorfes mit den auffällig gelben «Köpfen» dieser zu den Körbchenblütlern gehörenden Pflanze verglichen.
Birsfelden: Die jüngste Gemeinde des Kantons besass laut den Autoren des 1958er-Beitrags in den Heimatblättern keinen Scherznamen. In der lokalen Umgangssprache wird Birsfelden hingegen als Blätzbums bezeichnet. Die Herkunft des Namens ist unklar. Er könnte vom früheren Flugplatz auf dem Sternenfeld herrühren, wonach mit «Blatz» der Flugplatz und mit «Bums» die lärmigen Geräusche der Flugzeuge gemeint waren. Wahrscheinlicher ist laut Website der Gemeinde aber, dass der Name aus mittelalterlichen Zeiten stammt, als Prostituierte der potenziellen Kundschaft ihre entgeltlichen Dienste auf den Feldern anboten.
Böckten: Hirslöffel. Der Name bezieht sich wohl auf den früheren Anbau der Hirse oder auf die Vorliebe der Böckter für den Hirsebrei. Man vergleiche die Scherznamen Hirser für die Einwohner von Buchs (SG) und Hirsfresser für die Einwohner von Zug.
Bottmingen: Stäägestregger. Wer eine Stiege (Treppe) in die Länge strecken kann, wird als Alleskönner, Allerweltskünstler bezeichnet.
Bretzwil: Löffelstiil (Löffelstiel). In Kinderreimen oft gebrauchter Ausdruck (Lyyrum, laarum, Löffelstiil …). Fraglich, ob Löffel hier im Zusammenhang mit der tatsächlichen Bedeutung von Löffel oder eher im Sinne von Laffe, Lappi, verwendet wird.
Bubendorf: Wääiemüüler (Wähenmäuler). Grosser, weiter Mund, beziehungsweise Mensch mit solchem. Möglicherweise wird auf die «breite», gedehnte Aussprache der Leute des Hintern Frenkentals angespielt.
Buckten: Suursuppefrässer, Chrotte, Lüürehäfe. Suursuppe, wohl mit saurer Milch oder Essig zubereitete Suppe, war angeblich das Leibgericht der Buckter. Chrotte nach den auf den früheren Wässerwiesen sich zahlreich findenden Lurchen. Lüürechüübel, siehe Lyyrechübel unter Bärenwil.
Buus: Chatze. Wahrscheinlich entstanden, weil der Ortsname dem Lockruf für die Katze entspricht. (Chumm bus-bus oder chumm büs-büs!)
Diegten: Biirestiil. Eher Anspielung auf einen grossen Birnbaumbestand als Inbegriff des Wertlosen oder Übername von mageren Personen.
Diepflingen: pfelschnitzer. ielleicht orliebe der Diepflinger für Apfelgerichte oder Hinweis auf das häufige Vorkommen des Apfelbaumes.
Eptingen: Oofewüscher. Vor dem «Einschiessen» des Brotes in den Ofen wurde dieser mit einem eigens für diesen Zweck verwendeten Besen (Oofewüüsch) gereinigt. Der Scherzname bezieht sich wohl auf diese Tätigkeit.
Ettingen: Duubestöössel. Wohl zu Duubestöössel (= Sperber) oder Duubestööser (= Habicht). Nach der mündlichen Überlieferung kamen die Ettinger wegen einer Kirchenfahne zu ihrem Namen. Diese zeigte als Emblem des heiligen Geistes eine Taube, die eher einem Raubvogel glich. Weiterer Name: Kuckucker.
Frenkendorf: Löögelisuuger. Ähnlicher Ausdruck wie Fläschesuuger (= grosser Trinker). Löögele = trinken. Loogel, Löögeli = hölzernes Weingefäss mit Deckel und Schnabel.
Füllinsdorf: Güllerugger. Bezeichnung für Unke, Kröte. Im oberen Baselbiet wird die Larve der Schlammfliege, entsprechend ihrem Aufenthalt in Senkgruben und Jauchegruben, Güllerugger genannt. Der Scherzname bezieht sich wohl auf das früher versumpfte Gelände des Dorfbächleins, wo sowohl Lurche als aus Insektenlarven vorgekommen sein sollen.
Gelterkinden: Brootwurschtzipfel. Wahrscheinlich Hinweis auf eine Lieblingsspeise der Gelterkinder.
Giebenach: Biirestiil, Ziibelechracher. Vergleiche Diegten. Eher Beziehung zu grossem Birnbaumbestand und zu einer Lieblingsspeise (Biireschnitz) als Inbegriff des Wertlosen oder Übername von mageren Personen. Der zweitgenannte Scherzname erinnert an den wohl häufigen Anbau der Speisezwiebel.
Häfelfingen: Rauchlöcher. Hinweis auf die alte, kaminlose Rauchküche. In den kartographischen Aufnahmen des Basler Lohnherrn G. F. Meyer (1680) wird von Häfelfingen geschrieben: «Kein Hus hat kein Camin in diesem Dorff.» In jener Zeit standen in fast allen Baselbieter Dörfern neben den Ständerbauten mit Rauchküchen die stattlichen Dreisässenhäuser mit Kaminen. Der Übername der Häfelfinger geht also sehr weit zurück oder aber die alte Bauweise des Ständerbaus hat sich in diesem abgelegenen Dorf länger als in andern erhalten.
Hemmiken: Groppe. Zu Groppe, kleiner Fisch unserer Bäche, mit keulenförmiger Gestalt, plattem, krötenartigem Kopf und grossen, fächerartigen Brustflossen. Auch Neckname der Anwohner des Bodensees (Seegroppe).
Hersberg: Chrüüselidöörn. Nimmt Bezug auf die Grüselbeere, Stachelbeere, die oft in Lebhägen wild wächst.
Hölstein: Chatze,Chatzechöpf. Chatzechopf = primitiver Mörser, oft auf ein Holzstück montiert.
Itingen: Säubängel. Synonym zu Holzschlegel. Gemeint ist hier: derbe, grobe Leute. Im Aargau ist Säubängel ein volkstümlicher Pflanzenname für den rauhhaarigen Fuchsschwanz, ein lästiges Ackerunkraut.
Känerkinden: Fröschebäi. Der Name des Lurches ist sonst eher an Orte mit stehenden Gewässern gebunden (Rickenbach). Doch mochten die namengebenden Tiere auch in feuchten Örtlichkeiten wie in der Ei und auf der Riedmatt gehaust haben.
Kilchberg: Stäibräägler. Bräägle = mit prasselndem Geräusch schmoren, braten, rösten (z. B. bräägledi Härdöpfel = Rösti). Im Scherznamen Steibräägler wird wohl auf die Sparsamkeit und den angeblichen Geiz der Kilchberger angespielt.
Lampenberg: Ärbslizeller. Leute, welche die Erbsen beim Setzen abzählen, gelten ebenfalls als sparsam und gheebig.
Langenbruck: Zypperliränze, Zypperlischysser. Hinweis auf eine kleine grün-blaue Pflaume, die erst essbar wird, wenn ein Frost darüber gegangen ist. Sie gedieh auch recht gut in der Höhenlage von Langenbruck.
Läufelfingen: ilchmäuchli. ilchmäuchli = Milchbröchli, d. h. in Milch eingeweichte Brotbrocken. Anscheinend früher Leibspeise der Läufelfinger.
Lausen: Chüümiwegge (evtl. auch Chüümischnitzer). Scherzname nach einem in Lausen wohl üblichen Gebäck (Weggen = keilförmiges Milchbrot aus Weissmehl). Chüümischnitzer, wie Synonyme Rappenspalter, Batzechlemmer, Gyzchraage.
Lauwil: Süürmel (in der näheren Umgebung auch Chröpf). Ein Sürmel ist ein unfreundlicher, unwirscher, ungezogener Mensch. Der Übername «Loueler Chröpf» steht im Zusammenhang mit der in diesem Dorf früher häufigen Vergrösserung der Schilddrüse.
Liedertswil. Tschoopenermel, Tschoopeblätzer, Tschoopesüürmel. Volkstümlicher Namen von Liedertswil ist Tschoppehof (im Jahr 1530 wurde Durs Tschopp als Besitzer des Hofes von Liedertswil erwähnt). Dieser Name hat sich bis heute erhalten, obwohl die Familie Tschopp im 18. Jahrhundert als Bürgergeschlecht von Liedertswil im Mannesstamm erloschen ist. Die Begriffe Tschooppenermel und Tschooppeblätzer liegen nah beim ähnlich klingenden Wort Tschoope = Wams, Jacke, aus italienisch giubba. Süürmel siehe unter Lauwil.
Liestal: Däscheblätzer. Der Ausdruck kommt angeblich daher, weil die Liestaler einst das Gesuch ihres Schäfers um eine neue Tasche abschlägig beschieden und sich mit dem Beschluss begnügten, die alte «blätzen», also flicken zu lassen. «E Lieschtler Däsche» auch im Sinn einer schwatzhaften Einwohnerin des Städtchens. In der mündlichen Überlieferung ist auch der Neckname Hämmeli-gha bekannt. Die Liestaler rühmten sich gern, zum Mittagessen Schinken gehabt zu haben, während Überreste von «Chnöpfli» in Schnauz und Bart sie Lügen straften! Einst sagten ältere Liestaler: «Hammli gha z Mittag, wennene no der Chruttstiil zum Muulegge uus luegt.»
Lupsingen: Schmalzgrüebler, Schmutzgrüebler. Zu Schmalz, Schmutz = zerlassenes Schweinefett. Vielleicht Hinweis auf Reichtum der Lupsibärger an solchen Vorräten. Schmalzgruebe = bildliche Bezeichnung eines fruchtbaren Ortes. Vergleiche Guldgruebe!
Maisprach: Muuchaime, im oberen Baselbiet Mulchaime. Volkstümlicher Name für Grille, Heimchen (Gryllus), auch Heimuch genannt. Muuch = stiller, verschlossener Mensch, Duckmäuser.
Münchenstein: Chaabissteerzli, Chaabisstoorze. Vielleicht ausgedehnter Anbau der Kohlarten oder in übertragener Bedeutung: schwerfälliger, ungeschickter Mensch. Oder auch: Der Kiesboden des Birstals mit der geringen Humusschicht liess nie rechte Kabisköpfe aufkommen ; es gediehen lediglich Storzen mit einigen Blättchen daran. Die Münchensteiner wurden auch Hiibelirutscher (kleiner Holzschlitten) genannt.
Muttenz: Chrucke. Chrucke kann Krücke oder Schürstange (Oofechrucke) bedeuten. Vielleicht Hinweis auf die Spitalgut-Steine in Muttenz, die eine Krücke trugen, bestehend aus einem senkrechten Stab mit gebogener oder gerader Querstütze. Da das Spital zum heiligen Geist in Basel in Muttenz einen ausgedehnten Grundbesitz aufwies, wäre die Entstehung dieses Necknamens auf diese Weise möglich gewesen.
Niederdorf: Chutscheli, Kosename für Saugkalb. Bekannt ist auch der Neckname Güllerugger im Sinne von Unke, Kröte oder Rattenschwanzlarve der Schlammfliege. Vergleiche Füllinsdorf.
Nusshof: Nussbängel, Nusshöck. Der Neckname klingt an den Ortsnamen an. Bengel im Sinne eines ungeschliffenen, nichtsnutzigen Menschen; vielleicht wurde auch an die Prügel = Rundhölzer gedacht, womit etwa junge Leute Nüsse herunterzuschlagen pflegen.
Oberdorf: Chalber. Auch die Koseform Chutscheli wurde in den vergangenen Jahrzehnten gebraucht. Eher auf ungeschlachte (klobige), ungezogene junge Leute bezogen als Hinweis auf einen Zweig der Viehwirtschaft (Kälberzucht).
Oberwil: Chatzewaadel. Volkstümlicher Name für Zinnkraut, Acker-Schachtelhalm. Waadel ist auch eine alte Bezeichnung für Schwanz. Vielleicht bezieht sich der Neckname wirklich auf die Pflanze, wie in Binningen, wo auf dem Holeehübel ein Gebiet Chatzewaadelagger benannt wurde. Die Oberwiler bezeichnen sich scherzhafterweise als Schnägge, welcher Name auch den Pfeffingern zusteht. Dieser Neckname im Sinne von langsamen Menschen kommt in der deutschen Schweiz häufig vor.
Oltingen: Schoofrolle. Rolle = Kotklunker, umherhängende Mistknollen am Vieh, an Schafen. Vielleicht ist dieser Übername mit der Schafmatt (Schoofmet) in Beziehung zu bringen.
Ormalingen: Ziigerseckli. Ziger ist der käseartige, feste Bestandteil der geronnenen oder sauren Milch. Offenbar wurde bei seiner Gewinnung die noch wässerige Masse in ein leinenes Säcklein geleert und durch Kneten und Drücken desselben das Wasser herausgepresst. Warum die Ormalinger zu diesem Namen gekommen sind, muss offengelassen werden. Vorliebe für Ziger? Der Übername muss weit zurückgehen, findet sich doch dieses Zeichen auf einem Grenzstein auf Haberacker aus den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts gegen Rickenbach, der auf der Rückseite einen Frosch trägt. Siehe Rickenbach!
Pfeffingen: chnägge. eckname ür u angsame Menschen. Vergleiche Oberwil.
Pratteln: Chreeze. Chreeze, Synomym zu Hutte = aus Weiden geflochtener Tragkorb (Rückenkorb). Auch bildlicher Ausdruck für langsame Person.
Ramlinsburg: Chriechemüüler. Chrieche, Zypperli = Pflaumenschlehe, eine grün-blaue, kleine, rundliche Pflaume, die im Gebiet der Frenkentäler noch nicht ausgestorben ist. Noch heute (1958, die Red.) ist das Ramschbärger Zypperliwasser eine begehrte Spezialität.
Reigoldswil: Dannzapfesuuger. Dieser Scherzname, den die Reigoldswiler mit den Zeglingern gemeinsam haben, bezieht sich wohl auf den Nadelwaldreichtum dieser beiden grossräumigen Faltenjuragemeinden. Die Dannzapfesuuger in Reigoldswil sind in einem Relief am Schulbrünnlein und in einem Sgraffito «Im süesse Egge», das letztgenannte von Walter Eglin, verewigt.
Reinach: Linseschnitzer, auch Hoggemässer. Linseschnitzer als Synonym zu Rappespalter oder Chüümichnüpfer = allzu sparsame, geizige Personen. Der Ausdruck Hoggemässer (Rebmesser) ist ein Hinweis auf den einst bedeutenden Rebbau in Reinach.
Rickenbach: Frösch. Der Neckname stammt wohl aus der Zeit vor 1799, als unterhalb des Dorfes sich der grösste obrigkeitliche Fischweiher der Landschaft Basel ausdehnte (nach einer Vermessung aus dem Jahr 1618 umfasste er 370 Aren). Auf einem Grenzstein auf dem Haberacker aus den 1820er-Jahren ist der Frosch verewigt, die Rückseite ziert das Ormalinger Ziigerseckli.
Rothenfluh: Rossbolle, Rossschälle. Rossbolle = Pferdekot, Rosschälle = Schelle für Pferde oder Bezeichnung für die männlichen Geschlechtsteile. Schimpfname oder Hinweis auf früher häufigere Pferdehaltung.
Rümlingen: Eselsoore. Vielleicht im Zusammenhang mit dem Eselweg, der durchs Grindel (Krintal), der Eselholde entlang, unterhalb der Eselflue nach Rünenberg führt. Erwähnt auch der Scherzname Haasenäscht (Lage des Dorfes im Talgrunde?) und Flööjeger (Schimpfwort).
Rünenberg: Gäissfäckte. (Gäissblueme = Margrite). Als man um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Rünenberg unter Führung des Lehrers Strohmeier bestrebt war, die Kleegraswirtschaft zu fördern, stellte sich als erste Folge ein vermehrtes Auftreten der Weissen Wucherblume (Chrysanthemum leucanthemum) ein, was zur Bildung des Necknamens «Margrite» geführt haben soll. Auf Wunsch der Gemeindebehörde, welche die Bezeichnung Margrite mit Recht als Ehrennamen auffasste, wurde die genannte Blume 1944 in das neu geschaffene Gemeindewappen aufgenommen (in Blau silberne Margrite mit goldener Mitte).
Schönenbuch: Mäiechääferfrässer. Hinweis auf massenhaftes Vorkommen des Maikäfers oder Spottname für die Esslust der Schönenbucher.
Seltisberg: Äärbeerischnitzer. Hinweis auf den sparsamen, haushälterischen Sinn der Leute vom «Äärbeerihüübel» (Seltisberg). 1944 nahm die Gemeinde eine Erdbeerblüte als Gemeindesymbol in das Wappen auf.
Sissach: Raadschiineschläcker. Übername aus der Bauzeit der Centralbahn, der Linie Basel-Sissach, die ab Januar 1855 bis Liestal, ab Juni des gleichen Jahres bis Sissach betrieben wurde.
Tecknau: Höiel. Eule. Da der Gemeindebann des kleinen Eitaldorfes zur Hälfte aus Wald besteht (Steilhänge des schmalsohligen Eitales), waren vielleicht die hier häufigen Nachtraubvögel namengebend. Im übertragenen Sinne werden auch unordentliche, struppige Menschen als Heuel bezeichnet.
Tenniken: Hüürlig. Junges Wesen oder Gewächs, das im laufenden Jahr erzeugt ist. Zum Beispiel junges Rebenschoss oder junger, kleiner Fisch. In übertragenem Sinne spottende Bezeichnung für einen kleinen Menschen.
Therwil: Nüünenüünzger. Zur Erklärung: «99 Därwyler gänn 100 Nare.» Zuvor wurden die Therwiler auch Iltisse oder Igel genannt.
Thürnen: Schööferzäine. Zeine = runder oder länglicher, geflochtener Tragkorb mit zwei Handgriffen. Schäferzeine = grosse Zeine. Der Ausdruck kommt auch als Flurname vor. Im Buch «Basler Mundart» (1879) ist folgender Ausspruch angeführt: Er het es Muul wiene Schööferzäine!
Titterten: Harzblätz. Ein mit Baumharz bestrichener Lappen als Zugpflaster gegen Rheumatismen verwendet. Ein Zeitungskorrespondent aus Titterten zeichnete in früheren Jahren seine Beiträge als «Harzer». Vielleicht hängt der Titterter Übername auch mit der einstigen Harzgewinnung zusammen. In einem Manuskript der Vaterländischen Bibliothek aus dem Jahr 1667 wird erwähnt, die Bloondwaldung im Banne Bubendorf sei «den hartzern und lichtspanmachern verbant» (verboten). In der Nachbarschaft heissen die Titterter auch Schnitzränze oder Schnitz, weil sie sich dank des Reichtums an Kernobstbäumen den Bauch mit Schnitzen füllen können.
Waldenburg: Wölf. Die Lage des Jurastädtchens in einem steilwandigen Quertal, inmitten von Felsen und Wäldern, wo früher das Raubwild heimisch war, mochte zu diesem Necknamen Anlass gegeben haben. Vielleicht war auch der Gleichklang der Namen: Waldenburg-Wolberg-Wölf (Alliteration) im Spiel; vergleiche die alte Anlautformel «Wie wette Wollebärger Wyber Windle wäsche, wenn Wasser Wy weer?» Bei der Restaurierung des oberen Tores brachte Otto Plattner 1938 als Schildhalter bei der Sonnenuhr zwei schreitende Wölfe an.
Wenslingen: Graasrätsche. Name für den Wachtelkönig (Rallus crex), der auch Rätschvogel geheissen wird. Vielleicht auch im Zusammenhang mit der Rätsche = Flachsbreche. Wenn in Wenslingen sogar Gras «gerätscht» wird, soll damit eine unnütze Tätigkeit angedeutet werden?
Wintersingen: Chruttlämpe. Gekochte, ungehackte Kraut- und Kohlblätter. Frühere Lieblingsspeise der Wintersinger? Vergleiche Chruttstoorze (Allschwil) und Chaabisstoorze (Münchenstein).
Wittinsburg: Gleesauge, Stierenauge. Glees zu gleese = glotzen, gleesig = gläsern. Auge mit mattem oder erstorbenem Glanz oder Glasauge. Stierenauge = in Butter geschlagenes Ei, Spiegelei, Eier in Anke. Vielleicht früher Leibspeise der Wittinsburger.
Zeglingen: Dannzapfesuuger, Schoofzäine. Betreffend Tannzapfesuuger siehe unter Reigoldswil. Schoofzäine, Schäferzäine = grosser Tragkorb mit zwei Handgriffen. Vielleicht in übertragenem Sinne: Person mit grossem Mund. Siehe unter Thürnen.
Ziefen: Walchizäine. Walchi = wer unanständig und viel isst. Betreffend Zäine vergleiche mit Thürnen (Schööferzäine) und Zeglingen (Schoofzäine).
Zunzgen: Schueneegelchöpf. Bezieht sich auf die runde Kopfform einer Person oder erinnert an ein in Zunzgen vielleicht beliebtes Gericht: Schueneegel = in Semmelmehl gewendete und in Butter gebackene Schnitze von grossen Winterbirnen.
Aus den «Baselbieter Heimatblättern», Juli 1958: «Die Scherznamen der Baselbieter Gemeinden». Die «Baselbieter Heimatblätter» – das Organ der Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte Baselland – erscheinen seit 1936 und sind die einzige kulturhistorische Vierteljahreszeitschrift der Nordwestschweiz. Abonnenten haben Online-Zugriff auf alle bisher erschienenen Ausgaben. wwww.heimatblaetter.ch
Zwei Gruppen
vs. Die Scherznamen lassen sich laut einer Erläuterung der «Baselbieter Heimatblätter» aus dem Jahr 1958 sachlich in zwei Gruppen einteilen. Die erste betrifft allgemeine Schimpfwörter oder nennt Tiere, denen gewisse Eigenschaften nachgesagt werden. Die zweite, interessantere Gruppe charakterisiert die Bewohner des Ortes mit Eigenarten des Gemeindebannes, seiner Bebauung, mit früheren Wirtschaftsformen, Gewerben und örtlichen Bräuchen.
Das rund 140 Zeilen lange Gedicht aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mit den Dorf-Scherznamen des Frenkendörfers Heinrich Martin («Landschryyberhäiri») ist online unter www.volksstimme.ch zu finden.