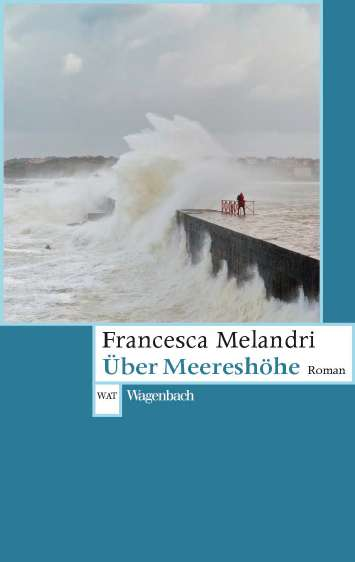Zu Besuch im Gefängnis
24.09.2020 RatgeberLesetipp | Francesca Melandri: «Über Meereshöhe»
Bei einem Besuch auf einer italienischen Gefängnisinsel – das Gefängnis ist für Terroristen und Schwerverbrecher eingerichtet – begegnen sich zwei sehr unterschiedliche ...
Lesetipp | Francesca Melandri: «Über Meereshöhe»
Bei einem Besuch auf einer italienischen Gefängnisinsel – das Gefängnis ist für Terroristen und Schwerverbrecher eingerichtet – begegnen sich zwei sehr unterschiedliche Menschen.
Andreas Leugger
Luisa, eine Bergbäuerin, Mutter von fünf Kindern, deren Mann wegen Gewalttätigkeit einsitzt, und Paolo, ein ehemaliger Gymnasiallehrer, dessen Sohn wegen terroristischer Morde verurteilt ist, treffen sich beim Gefängnisbesuch. Beide sind einsam und isoliert, aber so unterschiedlich sie sonst sind, bei dem Besuch auf der Insel kommen sie sich näher. Auch weil sie wegen eines Sturms nicht am selben Tag zurückfahren können.
Luisa sieht zum ersten Mal in ihrem Leben das Meer und ist fasziniert von der Schönheit und der Weite, die nicht durch Berge eingeengt wird. Sie hat sich auf den Besuch vorbereitet, zu Hause Ravioli für ihren Mann gekocht und dafür gesorgt, dass die Kinder zurechtkommen. Sie ist nicht unglücklich, dass ihr jähzorniger und gewalttätiger Mann nicht mehr neben ihr schläft. Aber es ist für sie als seine Ehefrau selbstverständlich, ihn regelmässig im Gefängnis zu besuchen. Sie ist eine einfache und offene Frau,die sich im Leben zu behaupten weiss und eine praktische Klugheit entwickelt hat.
Paolo hingegen tut sich schwer. Er kann nicht verstehen, dass sein Sohn zu einem brutalen, ideologisch verblendeten Mörder geworden ist, der sein Unrecht nicht einsehen will und weiterhin seinen «Klassenkampf» führt – auch im Gefängnis. Trotzdem überwiegt seine Vaterliebe und er besucht seinen Sohn regelmässig. Seine Frau Emilia ist an den Taten ihres Sohnes zerbrochen. Paolo macht sich ein schlechtes Gewissen, weil er seinen Sohn zur sozialen Gerechtigkeit erzogen hat.
Ein Unfall hindert die Besuchenden, rechtzeitig zur Fähre zurückzukehren, sodass sie auf der Insel übernachten müssen, unter der Obhut des Wächters Nitti Pierfrancesco. Dieser verliert offensichtlich gelegentlich die Kontrolle über sich selbst und verprügelt Häftlinge brutal. Während sie darauf warten, abgeholt zu werden, kommen Luisa und Paolo zum ersten Mal miteinander ins Gespräch. Als sie Paolo ganz naiv zu verstehen gibt, dass sie Glück hat in ihrem jetzigen Leben, erkennt er, dass sie alles wortwörtlich nimmt und sich nicht durch distanzierende Ironie schützt. Sie aber erkennt die Situation von Paolo: «Ein Sohn. Das ist schlimm.» Durch diese Reaktion fühlt sich Paolo, der sich sonst gern in seinen persönlichen Schmerz flüchtet, wie nie vorher verstanden.
Das Schöne und das Hässliche
Die beiden essen bei Nitti und seiner Ehefrau Maria Caterina, die als Lehrerin auf der Insel arbeitet und sehr besorgt ist, weil Nittis Kleider immer wieder Blutspuren aufweisen. Aber er kann nicht darüber reden. Luisa schätzt die Situation falsch ein und glaubt, Maria werde von ihrem Mann geschlagen – wie sie früher.
In der Nacht sinniert Paolo darüber, was Nitti gesagt hat: «Hier gibt es vieles nicht. Nur das Wort gibt es.» Er setzt das Gesagte in Bezug zu den revolutionären Phrasen seines Sohnes. Und er analysiert die «revolutionäre» Sprache der Terroristen im damaligen Italien als pervertiert, hässlich und selbstbetrügerisch. Aber auch ihr Verhalten als gnadenlos brutal. Auch Luisa kann nicht schlafen und ist dankbar, dass ihre Kinder ohne sie zurechtkommen. Sie tritt zu Paolo, der einen Zeitungsartikel mit einem Mädchenfoto betrachtet und fragt, wer darauf zu sehen sei. Es ist die kleine Tochter eines der Opfer, die sein Sohn ermordet hat. Er trägt das Bild immer bei sich, weil es das Letzte ist, was ihm von seinem Sohn geblieben ist. Weinend umarmen sie sich einen Moment und trösten sich. Sie sehen sich nicht mehr, auch weil die Gefangenen nach einem Aufstand verlegt werden. Aber sie telefonieren einmal miteinander und lachen gemeinsam über die Dummheit des Witzes, den einer der Wächter auf der Insel erzählt und den Luisa nicht begriffen hatte.
Melandri schreibt sehr dicht und anschaulich, aber auch mutig, indem sie sich nicht scheut, die Schönheit von Natur, Landschaft und Bauten auszumalen und dem Hässlich-Menschlichen entgegenzustellen: «Ja, das war es. Die Revolution, von der sein Sohn sprach, war ein klangvolles Wort für eine erbärmliche Sache; bei dieser Insel verhielt es sich genau umgekehrt.»
Sie gestaltet ihre Figuren sehr differenziert in ihren inneren Ängsten und Leiden, aber auch in ihren Freuden am Dasein. Nitti zum Beispiel kann seinen Unmut sadistisch-brutal an Gefangenen auslassen, aber er kann darüber nicht mit seiner Frau sprechen; aus Scham fehlen ihm die Worte, er frisst es in sich hinein und wird krank. Paolo entlarvt die revolutionären Parolen seines Sohnes als hohle Phrasen und ist entsetzt über seine Taten. Aber seine Vaterliebe gibt ihm die Hoffnung, um seinen Sohn nicht aufzugeben. Er zitiert Kant: «Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.» Das ist in etwa auch die Devise Melandris beim Schreiben dieses Buches, das sich wunderbar liest.
Francesca Melandri: «Über Meereshöhe», Wagenbach Verlag, Berlin, 2019. Secondhand-Bücher/ Buchantiquariat, Verein looserede-läse, Hauptstrasse 55, Sissach.